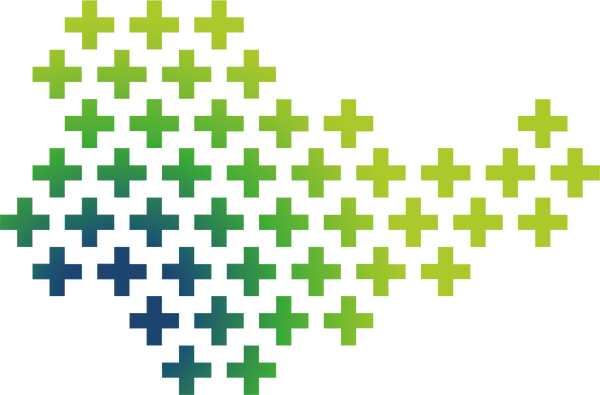Mit FABILE verbinden Anna Haag und Johanna Ernsing Nachhaltigkeit, Regionalität und Kreativität zu einem ganzheitlichen Gestaltungsansatz. Von individuell gefertigten Vollholzmöbeln bis zu innovativen Architekturprojekten in und um Weimar: Jedes Projekt erzählt eine Geschichte und setzt auf Kooperationen mit lokalen Partnern und Partnerinnen aus Handwerk, Fertigung und Kreativwirtschaft. FABILE schafft Räume, die nicht nur schön, sondern auch funktional, nachhaltig und gemeinschaftlich nutzbar sind. Wir haben uns mit Gründerin Anna Haag zum Austausch getroffen und mehr erfahren.
Fotos: Dominique Wollniok.

Wie kam es zu FABILE?
FABILE ist aus einer Mischung aus Neugier, Leidenschaft und Erfahrungen mit dem Werkstoff Holz entstanden. Schon während meines Abiturs habe ich in einer Tischlerei gearbeitet, später Innenarchitektur und schließlich Architektur in Weimar studiert. Holz war dabei immer der rote Faden, der mich fasziniert hat. Nach dem Studium kam ich durch größere Projekte in Kontakt mit regionalen Holzbetrieben und habe gemerkt, wie viel Potenzial hier vor Ort schlummert. Über die Gründungswerkstatt neudeli der Bauhaus-Universität Weimar und das EXIST-Women-Programm konnten wir die Idee zu FABILE konkretisieren und schließlich unser Unternehmen gründen. Heute steht das Projekt auf drei Säulen: regional, kooperativ und erzählerisch. Regional, weil wir Materialien bewusst vor Ort beziehen und mit Partnern und Partnerinnen aus Thüringen arbeiten. Kooperativ, weil FABILE von Anfang an durch den Austausch mit Sägewerken, Tischlereien und anderen Gestaltenden gewachsen ist. Und erzählerisch, weil jedes Möbelstück und jedes architektonische Projekt eine Geschichte in sich trägt – über seine Entstehung, seine Nutzung und seine Wandelbarkeit. Genau diese Mischung macht für uns den besonderen Reiz von FABILE aus.
Was fasziniert dich so sehr am Werkstoff Holz?
Meine Faszination für Holz hat mit meinem Hintergrund als Architektin zu tun. In meiner beruflichen Tätigkeit habe ich an der Umsetzung vieler öffentlicher Projekte mitgewirkt, etwa dem Bau von Kitas oder Schulen, und dabei intensiv mit Holzbau zu tun gehabt. Was mich dabei immer gestört hat, war, dass man für Projekte in Thüringen oft Bauteile aus Österreich oder noch weiter entfernten Regionen importieren musste, weil die Strukturen hier vor Ort meist noch zu kleinteilig waren. Zwar verändert sich das inzwischen, aber ich fand es damals schade, dass so viele Transportwege und Distanzen nötig waren, denn Holz allein macht ja noch keine Nachhaltigkeit. Entscheidend ist, den gesamten Produktionsprozess genauer zu betrachten: Woher kommt das Material, wie weit sind die Wege, wie wird es verarbeitet?
„Heute steht das Projekt auf drei Säulen: regional, kooperativ und erzählerisch“
Mit FABILE haben wir uns zu Beginn auf die einheimische Esche fokussiert, die sich durch ihre Formstabilität ideal für Möbel eignet. Denn das Eschensterben durch die sogenannte Eschentriebfäule macht das Holz im Sinne der Nachhaltigkeit zu einem spannenden Material – viele Bäume müssen ohnehin gefällt werden und durch die Verarbeitung in wertige Möbelstücke erhält das Holz ein zweites Leben. Holz erlaubt es außerdem, auch mit wenig Personal und Materialeinsatz sehr viel zu gestalten. Man kann Formen direkt erzeugen, braucht keine großen zusätzlichen Verbindungsmittel oder industriellen Ergänzungsprodukte und oft reicht schon eine kleine Ausstattung, um im Prinzip ein komplettes Gebäude entstehen zu lassen. Diese Möglichkeit, aus einem einzigen Material so viel herauszuholen und so eigenständig arbeiten zu können, war für mich der entscheidende Ansporn, dieses Material in den Fokus der Gründung zu rücken.

Wie unterscheidet sich ein Bauprojekt mit Holz in Bezug auf Planung und Umsetzung von klassischen Bauweisen?
Zum einen ist das Material selbst besonders: Holz kann fast unverarbeitet eingesetzt werden, während mit der Herstellung von Beton oder Stahl ein enormer CO2-Ausstoß und Energieeinsatz verbunden ist. Auch auf der Baustelle ist der Aufwand geringer, da Holz direkt vor Ort verarbeitet werden kann. Konstruktionsvollholz kann beispielsweise unmittelbar von Zimmereien oder Tischlereien verarbeitet werden. Diese Gewerke arbeiten oft mit kleinen, sehr gut ausgebildeten Teams, die viel Know-how haben.
Im Unterschied dazu stehen hinter dem Bauen mit Beton oder auch Ziegel meist große Firmen und Werke, die in einem viel größeren Radius produzieren und liefern. In unserer Region wächst hingegen vor allem Holz. Zudem gibt es historische Materialien wie den Weimarer Travertin oder auch Möglichkeiten, mit Recycling-Ziegeln zu arbeiten, wie ich sie etwa bei meiner Arbeit vor der Gründung bei Reich Architekten kennengelernt habe. Holz ist damit ein Baustein in einer Palette von Materialien, die nachwachsen oder recycelt werden können und die auf natürlichen Ressourcen basieren. Entscheidend ist dabei, kürzere Wege, den Energieeinsatz und den gesamten Lebenszyklus des Materials mitzudenken. Besonders bei kleineren Projekten, etwa im Möbelbau, zeigt sich der Vorteil noch deutlicher: Hier sind Experten und Expertinnen sowie Material direkt vor Ort verfügbar und ermöglichen so effiziente, ressourcenschonende Prozesse.
„Holz ist ein Baustein in einer Palette von Materialien, die nachwachsen oder recycelt werden können – entscheidend ist, Wege zu verkürzen und den gesamten Lebenszyklus mitzudenken“



Mit wem arbeitet ihr regional zusammen und welche Projekte habt ihr umgesetzt?
Ein Beispiel ist eine Vorplanung für die Deutsche Rentenversicherung: Wir haben einen Infostand für Messeauftritte entworfen, der langlebig ist, sich flexibel vergrößern und verkleinern lässt und verschiedene Nutzungen ermöglicht. Das passt ideal zu deren Nachhaltigkeitsbemühungen, bei denen im Unternehmen nach Verbesserungspotenzialen gesucht wird. Solche Projekte freuen uns sehr und genau in diese Richtung möchten wir auch künftig stärker arbeiten und voneinander lernen. Aktuell entsteht zudem in Zusammenarbeit mit der Stadtverwicklung die “Urbanothek“, ein gemeinschaftlich organisierter Raum in der Alten Feuerwache Weimar, der ab 2026 allen Menschen offensteht für Projekte, Veranstaltungen und Begegnungen. Durch den Austausch mit Gestalterin Christiane Werth von der Stadtverwicklung hat sich eine weitere spannende Möglichkeit für uns ergeben: In der Alten Feuerwache werden diverse Gewerbeflächen ausgebaut und in einen dieser Räume werden wir mit FABILE ab Herbst einziehen. Dort können wir Workshops veranstalten, vor allem aber auch handwerklich arbeiten und mal Lärm machen. Ein Teil des Raumes wird eine Kinder-Designwerkstatt, in der wir Selbstbau-Workshops für Möbel anbieten werden. So möchten wir Kindern den Zugang zum Material Holz erleichtern und Hemmschwellen abbauen.
Im planerischen Bereich begleiten wir momentan die Sanierung eines alten Gehöfts in Großschwabhausen mit insgesamt fünf Gebäuden. Spannend ist hier, die historische Bauweise von Bauernhäusern zu verstehen und mit modernen handwerklichen Techniken fortzuführen. Wir möchten auch künftig die Mischung aus Möbel- und Architekturprojekten weiter verfolgen, weil sich beide Gewerke gegenseitig bereichern. Neben Kreativen und Handwerksbetrieben aus der Region, arbeiten wir dafür projektbezogen mit Netzwerken, die Nachhaltigkeit zum Ziel haben, wie Auxesia, mit denen wir den Einsatz von Schafwollfleece für Möbelpolster-Füllungen eruieren. Aber auch mit Misses Mühltal aus Apolda, die einzigartige Upcycling-Unikate aus nicht mehr genutzten Kleidungsstücken und Stoffen kreiert. All diese Projekte haben eines gemeinsam: Sie verbinden Materialien mit Menschen, die Lust auf gemeinsames Arbeiten haben. Da wir im Kern zu zweit sind, sind wir auf Kooperationen angewiesen und erleben jedes Mal, wie produktiv es ist, wenn man sich zusammentut und im Dialog ist.
„Wir erleben jedes Mal, wie produktiv es ist, wenn man sich zusammentut und im Dialog ist“


Siehst du die Zukunft des Holzbaus als festen Bestandteil einer nachhaltigen Baukultur?
Ja, aber es hängt davon ab, wie wir ihn fortführen und anwenden. Drei Punkte erscheinen mir dabei besonders wichtig: Erstens die technische Optimierung von Baustoffen aus Naturfasern. Produkte wie Korkplatten, gepresste Strohfasern oder Pilz-Verbundwerkstoffe sind heute viel weiter entwickelt als noch zu meiner Studienzeit und die Produktpalette hat sich stark erweitert. Sie ermöglichen es, Lösungsmittel und problematische Bindemittel zu reduzieren, die bislang das Recycling erschwert haben. Holzbau ist eben nicht gleich Holzbau. Durch Innovation und Mehrfachverwendung nachhaltiger Materialien können diese Baustoffe nicht nur ökologisch sinnvoller, sondern auch wirtschaftlich wettbewerbsfähig werden.
Der zweite Punkt ist die stärkere Einbeziehung von Low-Tech-Lösungen. Viele klassische Verfahren aus der Denkmalpflege oder aus der klimatechnischen Tradition, etwa natürliche Lüftungs- und Kühlsysteme oder Materialien wie Lehm und Kalkputz, zeigen, dass man oft auf komplizierte Technik oder Kunststoffe verzichten kann. Statt immer höher, größer und komplexer zu bauen, sollten wir uns fragen: Wie können Gebäude einfacher und vor allem langfristig sinnvoll gestaltet werden?
Der dritte Punkt ist ein sozialer: Architektur muss mehr als partizipativer Prozess verstanden werden. Wenn Nutzende von Anfang an in die Planung einbezogen werden, entstehen Räume, die akzeptierter sind, länger genutzt werden und unterschiedliche Bedürfnisse abbilden können. Das reicht von flexiblen Nutzungskonzepten bis hin zu Projekten, die Kinder oder Familien aktiv einbeziehen. Partizipation bedeutet für mich Beobachtung, Austausch und das Projekt aus sich heraus wachsen zu lassen, bevor überhaupt gebaut wird.
All das zusammen – Materialinnovation, Low-Tech-Ansätze und soziale Prozesse – sorgen dafür, dass der Holzbau über sich hinauswachsen kann. Wenn wir die richtigen Fragen stellen und den Gebäuden dem Bauen mehr Zeit und angemessene Lösungsstrategien bieten, wird er ein zentraler Baustein einer wirklich nachhaltigen Baukultur.
„Wenn Nutzende von Anfang an in die Planung einbezogen werden, entstehen Räume, die akzeptierter sind, länger genutzt werden und unterschiedliche Bedürfnisse abbilden können“


Welche Verantwortung hat Architektur?
Eine, die Architekten und Architektinnen aktiv(er) wahrnehmen sollten. Als freier Beruf bietet die Architektur die Möglichkeit, Projekte bewusst zu steuern, Vergleiche anzustellen und Studien durchzuführen, um die Richtung eines Bauvorhabens zu beeinflussen. Durch die langsamen Prozesse prägen getroffene Entscheidungen Strukturen in Städten langfristig und hinterlassen dauerhafte Spuren. Deshalb ist es besonders wichtig, über den Tellerrand der eigenen Branche hinauszuschauen, die Bedürfnisse der Nutzenden in den Fokus zu stellen und abzuwägen, ob ein Projekt gesellschaftlichen Mehrwert bietet.
Hast du ein Wunschprojekt, das du gerne zukünftig umsetzen würdest
Als Wunschprojekt würde mich vor allem die Gestaltung von Lern- und Bewegungsräumen für Kinder, Schüler und Schülerinnen interessieren. Ich finde es spannend, moderne pädagogische Konzepte durch flexible Möbel und wandlungsfähige Raumgestaltungen zu unterstützen. Wichtig ist mir, dass Räume echte Mehrwerte bieten und Ko-Kreation fördern. Ein gutes Beispiel dafür ist das TADAH in der Schweiz, eine Kombination aus Kita und Coworking, die Familie und Beruf miteinander verbindet und Synergien in der Raumnutzung schafft. Solche Konzepte zeigen, wie Räume nicht nur funktional, sondern auch inspirierend und lebendig gestaltet werden können. Oder: die Alemannenschule Wutöschingen. Hier gibt es kaum noch klassische Klassenzimmer, stattdessen flexible Lernumgebungen wie Input-Räume für fachlichen Austausch, einen “Marktplatz“ mit Lerninseln für gemeinsames Arbeiten und Lernateliers für individuelles, konzentriertes Lernen.



Wie erlebst du Thüringen als Standort für kreatives Arbeiten und Kooperationen zwischen Design und Handwerk?
Ich habe in Thüringen und speziell in Weimar sehr gute Erfahrungen als passenden Kreativstandort gemacht. Schon nach dem Studium war klar, dass hier eine wahnsinnig hohe gestalterische Qualität vorhanden ist; oft etwas im Verborgenen, aber absolut konkurrenzfähig mit Gestaltenden aus anderen Bundesländern. Das Potenzial liegt für mich ganz klar in der Verbindung von Design, Handwerk und der kleinteiligen, oft ländlichen Struktur Thüringens. Hier gibt es viele kleine Betriebe, mit denen man gemeinsam spannende Dinge umsetzen kann. Ein Beispiel ist das Sägewerk in Unterwellenborn, mit dem wir zusammenarbeiten: Der Inhaber, Maik, ist eigentlich Wirtschaftsingenieur, hat aber den elterlichen Hof übernommen und begonnen, den umliegenden Forst wieder zu bewirtschaften. Solche Verbindungen zwischen Stadt und Land schaffen ein starkes Netz und eröffnen viele Möglichkeiten für regionale Produktionen. Wichtig ist dabei, die Regionalität bewusst mitzudenken. Man muss sich zwar erst die Mühe machen, die richtigen Partnerschaften zu finden, aber genau das bringt große Vorteile in der Zusammenarbeit. Auch die Unterstützung durch Netzwerke wie das ThEx, die THAK oder das neudeli ist unglaublich wertvoll. Darüber entstehen Kontakte, Kooperationen und auch Freundschaften, die die Arbeit tragen. Besonders die gegenseitige Unterstützung unter Frauen durch das Projekt EmpowHer, die ThEx Frauensache und die Mitglieder der Architektenkammer empfinde ich als großen Gewinn, weil es das Netzwerken erleichtert und stärkt. Für mich ist Thüringen deshalb genau der richtige Ort und jetzt ist die richtige Zeit, um neue Projekte anzustoßen und das kreative Potenzial der Region sichtbar zu machen.
Kontakt
Anna Haag
FABILE
www.fabile.de/kontakt
Mail: hallo@fabile.de
LinkedIn
Instagram: @fabile.weimar
Dein Interview auf unserer Webseite?
Kontaktiere mich!
Nina Palme
Kommunikation
np@thueringen-kreativ.de0151 / 1290 4638Das könnte dir auch gefallen: