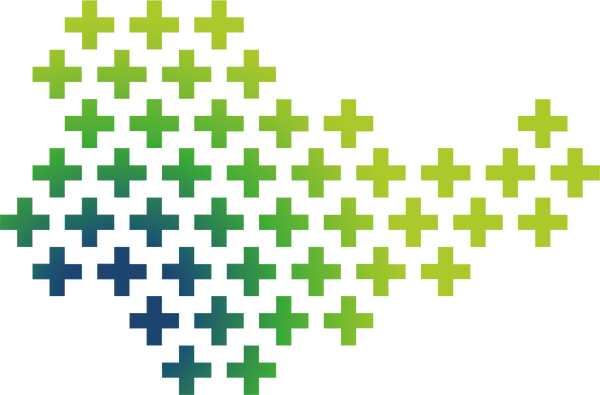Ein Flyer der Fachhochschule Erfurt veränderte sein Leben: Eigentlich ausgebildeter Elektriker, fand Thomas Schmidt nach der Wende eher zufällig zur Architektur – heute prägt sein Büro “herrschmidt architekten BDA” das Erfurter Stadtbild mit. Vor allem die Um- und Neugestaltung historischer Bauten haben es dem 54-jährigen angetan. Er betrachtet sie als lebendige Zeitzeugen und Chancen für nachhaltige Stadtentwicklung: Ob die kreative Revitalisierung der ehemaligen Industriebrache Kontor im Norden der Stadt oder aktuelle Projekte wie die Defensionskaserne und das KulturQuartier – sie alle folgen der Idee des Bauens im Bestand und wollen Orte der Kultur, Kreativwirtschaft und gesellschaftlichen Diskurses sein. Im Interview spricht er über kreative Transformationen, die Balance zwischen Erhalt und Eingriff und warum Architektur mehr mit Kommunikation als mit Beton zu tun hat.
Was fasziniert dich besonders am Bauen im Bestand?
Ich habe mich immer für Kunst und Kultur interessiert, aber ich bin kein Künstler. Ich versuche Räume für Kunst und Kultur zu bauen und vor allem für die Menschen, die sich darin bewegen. Gerade in Erfurt, einer Stadt mit einer unglaublichen historischen Substanz, gibt es so viele spannende Objekte, die eine neue Nutzung verdienen. Das ehemalige Schauspielhaus, heute bekannt als KulturQuartier, ist ein gutes Beispiel: Ein Gebäude, das seit über 100 Jahren in bester Lage steht, muss nicht einfach abgerissen werden. Viele Menschen haben eine Verbindung zu diesem Ort und es ist wichtig, diesen emotionalen und architektonischen Wert zu erhalten. Ich finde es spannend, die geschichtliche Kontinuität zu bewahren und zeitgemäße kulturelle Inhalte hineinzugeben, die die Menschen einer Stadt hier zusammenbringen.
Bei der Neugestaltung solcher Häuser arbeiten wir von herrschmidt architekten BDA nicht nur mit nachhaltigen Baustoffen, sondern beziehen vor allem die Materialien in unsere architektonischen Konzepte mit ein, die bereits vorhanden sind. Viele alte Gebäude bestehen ohnehin aus mineralischen und organischen Bausubstanzen wie Lehm und Holz und enthalten keine chemischen Zusatzstoffe. Das ist ein unglaublicher Vorteil. Der nachhaltigste Bau ist der, den man nicht neu bauen muss. Bauen im Bestand ist der beste Weg, Ressourcen zu schonen. Leider wurden in den 1990ern viele Gebäude abgerissen, die heute wertvoll wären. Zum Glück hat sich der Zeitgeist gewandelt. Wir denken heute viel mehr über Materialkreisläufe nach, über sortenreines Trennen und Wiederverwertung. Ich bin ein großer Fan von Holz als Baustoff, aber auch Lehm wird oft unterschätzt. Das sind beide regionale und natürliche Materialien mit fantastischen Eigenschaften. Gleichzeitig entwickeln sich neue Technologien, etwa das Drucken von Gebäuden. Da passiert gerade unglaublich viel.
“Alte Gebäude abzureißen ist einfach – sie zu erhalten und neu zu denken, eine Herausforderung“


Wie lassen sich hierbei historische Strukturen mit modernen Nutzungsanforderungen in Einklang bringen?
Besser, als man denkt. Nehmen wir die ehemalige Defensionskaserne auf der Festungsanlage Petersberg: Früher waren in diesem Gebäude Soldaten eingesperrt, zusammen mit ihren Kanonen, die aus dem Haus abgefeuert wurden. Diese einst militärische und verschlossene Bedeutung wollten wir aufbrechen, um daraus ein lebendiges und zeitgemäßes Gebäude für kreative Nutzungen zu machen. Vom ursprünglichen Zweck des Gebäudes erzählen heute noch die drei Meter dicken Wände, innen findet man eine preußische, fast mathematische Struktur mit zweigeschossigen Tonnengewölben, aber auch kleine verschachtelte Gänge und Nischen vor. Durch die Deckenhöhe bekommen einige Räume eine fast schon sakrale Atmosphäre. Das kann man mit Respekt vor der alten Substanz modern (um-)nutzen.
Wir haben dort gezielt die innere Struktur weiter geöffnet, Treppen eingebaut und so die Ebenen als kommunikative Räume verbunden. Besonders im Eingangsbereich haben wir das Haus behutsam aufgebrochen, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen und alles großzügiger gestaltet, damit mehr Licht hineinfließt. Die Defensionskaserne soll nach Fertigstellung vor allem Büros für Kreativschaffende aus Thüringen bieten, aber durch Kulturevents und Ausstellungen auch Begegnungsort sein. Viele verschiedene Menschen werden sich hier tummeln. Deshalb ist es wichtig, dass der Innenraum intuitiv erfassbar wird, einladend wirkt, aber auch kommunikative Räume für Dialoge entstehen. Unser Ziel ist es, Offenheit zu schaffen – räumlich, funktional und im übertragenen Sinne.
Welche Herausforderungen gibt es beim Arbeiten im Bestand?
Es braucht bei derartigen Projekten mehr Planung, Sorgfalt und vor allen Dingen eine sehr gute Bauleitung vor Ort. Alte Gebäude sind oft nicht exakt vermessen, da fehlen einige Zentimeter hier und da. Man muss viel improvisieren und anpassen und vor allem immer wieder nachmessen. Zusätzlich müssen moderne Anforderungen wie Brandschutz, Wärmeschutz und Haustechnik integriert werden. Große Säle brauchen beispielsweise eine mechanische Be- und Entlüftung. Dabei darf die historische Bausubstanz jedoch nicht durch massive Eingriffe beschädigt werden. Die größte Herausforderung besteht darin, den Bestand so weiterzuentwickeln, dass er funktional und nachhaltig nutzbar wird, ohne aber seinen ursprünglichen Charakter und die besondere Atmosphäre – die sogenannte “Lost Places Attitude“ – zu verlieren.
„Die größte Herausforderung besteht darin, den Bestand so weiterzuentwickeln, dass er funktional und nachhaltig nutzbar wird, ohne aber seinen ursprünglichen Charakter und die besondere Atmosphäre – die sogenannte ‚Lost Places Attitude‘ – zu verlieren“

Die “Lost Places Attitude“ ist besonders beim Kontor spürbar. Wie habt ihr es dort geschafft, die Geschichte zu bewahren und dem Ort gleichzeitig einen neuen Anstrich zu verleihen?
Das Kontor ist eines meiner liebsten Projekte, das ich gemeinsam mit meinem ehemaligen Studienkollegen, dem Bauherrn und Eigentümer Frank Sonnabend, umgesetzt habe. Besonders während des Leerstands wurde das große Areal der ehemaligen Großhandelsgesellschaft der DDR aus dem Jahr 1959, welches bis 1991 in Nutzung war, von der Sprayer-Szene okkupiert und geprägt – ein Sediment der Geschichte, das einen Teil der Vergangenheit des Ortes widerspiegelt. Diese Spuren haben wir bewusst erhalten und in die Gestaltung einfließen lassen. Nun wabern durch die lichtdurchfluteten Gänge, an die die verglasten Büros angrenzen, die Graffitis als Teil des Gesamtkonzepts. Wir haben dort kommunikative Räume geschaffen, Galerieebenen mit Lufträumen in den Büros geschaffen, auf die man klettern kann, fast wie ein Piratennest. Man kann in die Büros reinschauen, es gibt Interaktion. Zusätzlich sind dort urbane Projekte entstanden, etwa ein großer Garten auf den alten Gleisanlagen mit Obst und Gemüse oder Bienenstöcke – das war nicht geplant, aber es hat das Areal unglaublich bereichert.
Trotz der modernen Umgestaltung und -nutzung stand die historische Identität des Ortes stets im Vordergrund. Denn einen Neubau wollten wir nicht; die sind oft seelenlos, da sie sich ihre Geschichte erst erarbeiten müssen, während das Kontor seine bereits erlebte Vergangenheit sichtbar in sich trägt.
“Architektur sollte nicht nur gebaut, sondern erzählt werden”


Welche Bedeutung hat die Wiederbelebung solcher Orte für die Identität einer Stadt?
Die Wiederbelebung solcher Orte kann eine enorme Bedeutung für die Identität einer Stadt haben – und ich hoffe, dass sie in naher Zukunft noch weiter wächst. Natürlich braucht es Mut, solche Projekte verstärkt zu fokussieren. Aber ich bin optimistisch: Wir stehen vor einem großen Wandel in der Architektur, hin zu nachhaltigeren, durchdachten Lösungen. Und das ist eine Entwicklung, die ich mit großer Freude begleite. Eine Idee, die ich zum Beispiel verfolge, sind innovative Konzepte für Parkhäuser – wenn wir Mobilität neu denken und damit den Bestand an PKW zukünftig reduzieren, könnte man diese zu vielfältigen Orten umnutzen. Sie sind in der Regel wie ein flexibles Regal mit offenen, gestapelten Ebenen. Verschiedene Nutzungen wie ein Skaterpark, gastronomische und begrünte Flächen aber auch Wohnungen können dort ineinandergreifen. Jeder sollte die Augen offen halten für Orte mit Potenzial. Wenn wir gemeinsam Ideen entwickeln, miteinander reden und aufmerksam bleiben, können wir viel erreichen.
Man sieht die positiven Entwicklungen von derartigen Umnutzungen sehr gut auf dem Petersberg. Die Geschichte des Ortes reicht mindestens bis ins Jahr 1040 zurück. Fast 1000 Jahre Klostergeschichte und gesellschaftliche Bedeutung prägen diesen Ort. Dennoch war er über Jahrzehnte ein weißer Fleck, eine No-Go-Area. Erst in den letzten Jahren hat ein Wandel eingesetzt, der mit der BUGA 2021 einen entscheidenden Impuls erhielt. Sie wirkte wie ein “Dosenöffner“: Plötzlich kamen unzählige Menschen, erkundeten das Gelände, spazierten auf den Wegen und belebten den Petersberg neu. Heute entwickelt er sich weiter zu einem Raum für Begegnung, Austausch und Ideen – mit dem Potenzial, in den kommenden Jahrzehnten zu einem echten Zukunftsort zu werden. Ob die Pop-up-Ausstellungshalle oder andere offene Plattformen für Soziokultur, Konzerte und Politik. All das sind wichtige Angebote, in denen Menschen zusammen und ins Gespräch kommen können. Gerade in der heutigen Zeit ist der Dialog essenziell – wir müssen miteinander reden, um gemeinsam Perspektiven für die Stadt und die Gesellschaft zu entwickeln.

Was treibt dich persönlich an?
Mir geht es immer darum, Räume für Menschen zu schaffen. Raum macht etwas mit uns, er beeinflusst unser Verhalten. Ich habe früher als Kind viele Abenteuerromane gelesen, Jules Verne oder Romane über Piraten. Da ging es oft um verborgene Welten, Höhlen, Schatzkammern. Diese Faszination für Raum hat mich nie losgelassen. Später begann ich, meine Umgebung bewusst wahrzunehmen – sei es auf Reisen oder einfach bei Spaziergängen durch Erfurt. Diese Stadt ist voller beeindruckender Räume, sowohl innen als auch außen. Besonders fasziniert mich die Predigerkirche mit ihrer mathematischen Klarheit und dem Spiel von Licht und Struktur. Wenn ich solche Orte betrete, frage ich mich immer: Warum wirken sie so auf mich? Liegt es an der Architektur, der Bemalung oder am Licht? In Erfurt entdecke ich ständig neue Details, die sich in meinem Gedächtnis sammeln. So entsteht mit der Zeit eine innere Bibliothek an Eindrücken und Inspirationen – eine schöne Kulturtechnik, die sich über Jahre entwickelt hat.
Kontakt
www.herrschmidt-architekten.de
Instagram: @herrschmidtarchitekten
THAK Tipp:
Wer mehr über das Bauen im Bestand erfahren möchte, kann Thomas übrigens live erleben: Bei unserer #kreativgelöst: Zukunft Bauen gibt er am 10. Juli einen 15-minütigen Impuls zu seinen Projekten.
Dein Interview auf unserer Webseite?
Kontaktiere mich!
Nina Palme
Kommunikation
np@thueringen-kreativ.de0151 / 1290 4638Das könnte dir auch gefallen: