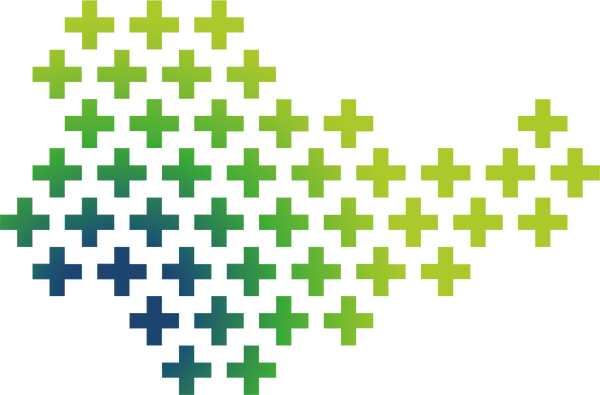Nachhaltigkeit, Gestaltung, innovative Materialforschung, Technologie, Wissenschaft und Videografie – der junge Kreativschaffende Friedrich Gerlach bewegt sich als Designer genau an diesen Schnittstellen. Aus dem Erfahrungsschatz der unterschiedlichen Bereiche entwickelt er visionäre Designprojekte. Durch seine Arbeit möchte er vor allem für alternative Materialverfahren und nachhaltige Prozesse in der Gestaltung von Produkten sensibilisieren und zeigen, was im Bereich des nachhaltigen Produktdesigns alles möglich ist. In den vergangenen Jahren entwickelte er verschiedene Herstellungsverfahren, die Produkte ressourcenschonend und kreislauffähig machen, zum Beispiel ein Sitzmöbel aus Biozement, ein Sofa aus Holzresten aus dem 3D-Drucker oder Zahnbürsten aus FFP2-Masken. Woher nimmt Friedrich die Inspiration für solche zukunftsweisenden Ideen? Was treibt ihn persönlich an? Und wie kann (und muss) Design nachhaltigen Wandel bewirken?
Material statt Form: Ein neues Designverständnis
Ein breites Lächeln erwartet uns, als wir Friedrich im Zoom-Raum zum Interview antreffen. Hinter seinem lilafarbenen Pullover türmt sich ein mit Designbüchern gefülltes Regal auf. Seit vielen Jahren ist Friedrich bereits neben seinem Studium als selbstständiger Designer tätig. Sein Ziel: Möglichkeitsräume für eine nachhaltige Produktion von Möbeln und Gegenständen der Zukunft und Gegenwart entwickeln. Dafür setzt er sich in seinem Studium im Fachbereich Design an der Burg Giebichenstein in Halle nicht nur mit nachhaltiger Designtheorie auseinander, sondern auch mit Wissenschaftler:innen und Produktionsstätten. Was ihn täglich begleitet, ist die Faszination für neue Technologien und innovative Materialien in der Produktherstellung, die weltweit entwickelt werden. Dennoch scheint das Produktdesign dieses wertvolle Wissen noch zu wenig zu nutzen. Hersteller:innen scheinen oftmals in der Vergangenheit stecken geblieben zu sein: Noch immer dominieren Plastik und Materialverklebungen in der Industrie. Produkte werden so gestaltet, dass sie weder langlebig sind noch in einen Ressourcenkreislauf zurückgeführt werden können. “Wir müssen die Entwicklung und Herstellung von Produkten ganz neu denken“, sagt Friedrich. Für ihn bedeutet das, Nachhaltigkeit von Anfang an mitzudenken und sie dann sinnvoll ins Design zu übertragen. Deshalb beginnt sein Gestaltungsprozess nicht mit der Form, sondern mit dem Material – „Form follows function“ wird somit zu „Form follows material“: Erst wenn er die Materialeigenschaften verstanden hat, kann er die passende Form dazu entwickeln.
Neue Möglichkeiten durch technologische Innovation: 3D-Druck mit Holzresten
Aktuell arbeitet und forscht der Kreative zusammen mit der FIT AG aus Lupburg bei Regensburg wieder an neuen Materialien und Technologien. Gemeinsam mit dem weltweit anerkannten Spezialisten für Additives Design und Additive Fertigung sowie weiteren Designer:innen testet er das Potential eines 3D-Druckverfahrens mit innovativem Material für die Möbelherstellung. Holzreste werden zu feinen Spänen verarbeitet und schichtweise in ein Bett gedruckt, wo sie mit einem mineralischen Bindemittel verbunden werden. So entstehen feuchte Streifen, die Schicht für Schicht zu Möbeln geformt werden. Die Kooperation entstand 2023, als der Jungdesigner mit vier weiteren Gestalter:innen einen Preis für eine vorangegangene Arbeit gewann und dann im Team mit den anderen Gewinner:innen die Fit Group zu einer Kooperation einlud. “Wir dürfen einen der weltweit schnellsten 3D-Drucker nutzen“, berichtet er. Mit seinem Team hat er untersucht, welche Formen sich mit dem Verfahren möglichst effizient gestalten lassen. Das Ergebnis: Ein Sofa, das in einem kompakten Prozess gedruckt wird. “Dieser Drucker ist vier mal zweieinhalb Meter groß und schafft zwei Quadratmeter pro Stunde – eine unglaubliche Geschwindigkeit“, erzählt der gebürtige Thüringer begeistert. Die Holzsägespäne-Schichten werden mit mineralischem Binder fixiert und dann zu einem stabilen Block verdichtet. “Das Beste daran: Null Materialverlust. Die übrig gebliebenen Sägespäne können einfach abgesaugt und wieder verdruckt werden. Das gedruckte Möbelstück ist durch den mineralischen Binder wieder in die Natur zurückführbar oder kann in eine andere Form recycelt werden, was bei traditionell hergestellten Möbeln nicht möglich ist.“

Nachhaltigkeit als Standard etablieren – nicht als Ausnahme
Nicht nur die Materialeffizienz ist innovativ, sondern auch die Gestaltungsmöglichkeiten: “Durch den Druckprozess können wir Rundungen viel freier gestalten, ohne sie aus Platten zusägen und verleimen zu müssen“, erklärt Gerlach. “Herkömmliche Möbel bestehen oft aus einer Kombination von verleimtem Holz, Schaumstoff und weiteren Materialien, die miteinander vernagelt oder getackert sind – ein Verbund, der kaum recycelt werden kann und meist verbrannt wird. Ich wollte das von Anfang an anders denken“, sagt er. Seine Lösung: Eine nachhaltige Sitzschale bildet die Basis für das Sofa, die mit einem Baumwoll-Textil bespannt wird. Der Oberbezug besteht aus 100% Schafwolle, die die deutsche Weberei Rohi Stoffe GmbH ohne Polyamid-Anteil entwickelt hat.
Neben dem Sofa sind auch Sessel und die Produktion anderer Möbelstücke mit diesem Verfahren denkbar. “Wir haben unsere Prototypen auf einer Messe vorgestellt und direkt den Preis für die beste Präsentation von Designer:innen auf der Messe gewonnen “, erzählt der Kreativschaffende stolz. Jetzt geht es für ihn darum, das Projekt weiterzuentwickeln und Möbelmarken zu finden, die die Entwürfe in ihr Portfolio aufnehmen wollen. “Die Zusammenarbeit mit der Druckfirma war ein großer Schritt, aber wir stehen erst am Anfang“, sagt er. Sein Ziel: Nachhaltiges Design nicht als Ausnahme, sondern als neuen Standard in der Möbelbranche zu etablieren.


Herausforderungen in der Industrie: Zwischen Vision und Realität
Veränderung müssen bereits am Anfang eines Produktzyklusses mit bedacht werden, so Friedrich: “Einerseits soll aus wirtschaftlicher Sicht der Firmen Konsum weiter angekurbelt werden, andererseits muss nachhaltiges Handeln integraler Bestandteil des Designs werden. Genau das wird aktuell in der Ausbildung von Designer:innen vermittelt: Produkte nicht nur zu entwerfen, sondern ihre gesamten Lebenszyklen zu durchdenken – von der Materialwahl bis zur Wiederverwertung.” Doch die Realität sieht oft anders aus: “In der Wirtschaft stoßen wir als junge Kreative mit diesen Ansätzen noch auf viel Widerstand“, sagt er. Die Wegwerfkultur hat nach wie vor Bestand und es ist schwierig, wirtschaftliche Anreize zu schaffen, die Nachhaltigkeit für Unternehmen wirklich attraktiv machen. “Die aktuellen Anreize funktionieren einfach nicht. Für viele Unternehmen ergibt es wirtschaftlich keinen Sinn, nachhaltig zu handeln. Dabei sind wir uns doch alle einig, dass es niemanden guttut, Dinge zu besitzen, die ständig kaputt gehen und immer wieder neu gekauft werden müssen.” Trotzdem glaubt Friedrich daran, dass die nächste Generation von Designer:innen endlich Veränderung bringen kann, bringen muss, “indem sie nicht nur gestalten, sondern auch als Berater:innen auftreten und Unternehmen dazu bewegen, Qualität und Langlebigkeit in den Fokus zu rücken.” Denn das Wegwerfdenken muss aufhören. Er ist überzeugt, dass Gestalter:innen in Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen stärker in die Produktionsprozesse eingebunden werden sollten – nicht nur, um Produkte nachhaltiger zu machen, sondern um grundlegende Werte in die gesellschaftliche Diskussion einzubringen.
“Ich arbeite immer mit Leuten zusammen, die aus unterschiedlichen Disziplinen kommen. Es ist wichtig, bei der nachhaltigen Transformation der Herstellung von Produkten verschiedene Blickwinkel einzubeziehen. Vielleicht macht es Sinn, Dinge fest zu verkleben, aber man muss mit den Menschen sprechen, die die Produkte später entsorgen. Man muss das Ende des Produktes von Anfang an im Blick haben.” Und weiter: “Es geht nicht nur um Verkaufszahlen und Profite, sondern darum, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen.“ Diese Fragen seien deshalb nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch zu betrachten. “Wenn wir das Thema Nachhaltigkeit weiter vor uns herschieben, wird es uns in der Zukunft auf die Füße fallen“, sagt Friedrich. Design neu zu denken, radikal nachhaltig, mit Blick auf Materialkreisläufe und ressourcenschonende Prozesse – das ist das Ziel in seinem täglichen Tun – für die Zukunft, aber auch für die Gegenwart.

Verantwortung und Schuld
Die aktuelle Konsumphilosophie kommt dem Designer immer absurder vor. Das beginnt schon bei den kleinen Dingen im Alltag: “Wir kaufen etwas, von dem 30 Prozent nur aus Verpackung besteht – und die werfen wir sofort weg.“ Doch das, was wir als Müll sehen, sei nur ein Bruchteil des eigentlichen Problems. “Man könnte sagen, das Design ist schuld. Denn unser Beruf war lange darauf ausgelegt, Kaufanreize zu schaffen – also genau das System zu stützen, das diesen übermäßigen Konsum antreibt.“ Doch für ihn ist klar: Das darf so nicht bleiben. “Wir müssen unser Berufsbild komplett neu denken. Wir als Designer:innen sollten steuern, welche Produkte überhaupt auf den Markt kommen, wie sie genutzt werden, wie sie aussehen und welche Folgen sie in Zukunft haben.“
Nachhaltigkeit als Experimentierfeld
Friedrich Gerlachs Experimente, wie das Biozement-Projekt, das er zusammen mit seiner Studienkollegin Julia Huhnholz umgesetzt hat, zeigen, wie nachhaltige Alternativen für ressourcenintensive Industrien aussehen können. Gemeinsam erforschten die beiden eine Methode, bei der Sand – eine immer knapper werdende Ressource – durch das Abfallprodukt Ziegelgranulat ersetzt wurde. Statt eines energieintensiven Brennprozesses nutzten sie zudem Bakterien, um die Materialien miteinander zu verbinden. “Wir haben auf natürliche Bioprozesse zurückgegriffen, um Ressourcen zu sparen und alternative Baustoffe zu schaffen.“ Die Zusammenarbeit mit Forscher:innen aus Südafrika öffnete hierbei neue Möglichkeiten: “Harnstoff, der in großen Mengen als Abfallprodukt anfällt, kann diesen Mineralisierungsprozess antreiben. Viele Materialien, die heute ungenutzt bleiben, sind eigentlich wertvolle Rohstoffe. So kann man mit Abfallstoffen und Mikroorganismen, Brennprozesse umgehen, die im Normalfall über 1000 Grad Celsius benötigen und somit eine Menge Energie sparen.”
Mit seinem Team hat Gerlach die Erkenntnisse auf Messen präsentiert, Preise gewonnen, Vorträge gehalten und andere dazu eingeladen, weiter zu experimentieren. Nun liegt es an den Unternehmen, die aufgezeigten Potenziale und den bereits geleisteten Wissenstransfer aus der Wissenschaft aufzugreifen, die Ideen weiterzuentwickeln und sie mutig in die Praxis umzusetzen. “Wir haben Ideen aus der Wissenschaft aufgespürt, sie weiterentwickelt und zugänglicher gemacht – jetzt braucht es mutige Leute, die mitziehen.“
“Wir haben Ideen aus der Wissenschaft aufgespürt, sie weiterentwickelt und zugänglicher gemacht – jetzt braucht es mutige Leute, die mitziehen“



Ko-Kreation und Kollaboration als Schlüssel zu nachhaltigen Visionen
Woher kommt die Inspiration zu solchen Ideen? “Es gibt so viele faszinierende Prozesse in der Natur, die wir uns für Materialien und Herstellungsverfahren abschauen können“, sagt der Produktdesigner. Sein Antrieb besteht darin,verschiedene Disziplinen zusammenzubringen, Schnittstellen zu erkennen und neue Lösungen zu entwickeln. Dabei spielt der interdisziplinäre Austausch mit anderen eine zentrale Rolle. Friedrich verbringt viel Zeit damit, mit Menschen aus unterschiedlichen Fachbereichen zu sprechen – Wissenschaftler:innen, Techniker:innen, Unternehmer:innen. “Oft haben Leute großartige Ideen, sind aber so auf ihr Spezialgebiet fokussiert, dass sie die Übertragbarkeit auf andere Bereiche gar nicht sehen.“ Hier setzt er an, findet die Verbindungen, die Potenziale, und denkt sie weiter. Besonders spannend findet er es, direkt in Unternehmen und Forschungsinstitute zu gehen. “Ich bin gerne und oft bei Unternehmen, Produktionsstätten und Instituten vor Ort, schaue mir die Möglichkeiten und Materialproben an, spreche mit den Leuten und frage mich: In welchen Produkten könnte das Anwendung finden? Wie könnte das in anderen Maßstäben funktionieren?“ Auch wissenschaftliche Paper liest er regelmäßig, um Verfahren besser zu verstehen und weiterzudenken.
Um den Wandel zu ermöglichen, braucht es laut dem Designer Ko-Kreation und Kollaboration mit interdisziplinären Teams aus Kreativwirtschaft, Wissenschaft und Industrie. Manchmal ergeben sich Kooperationen zufällig, manchmal geht er gezielt auf Menschen zu. “Beim Projekt mit der 3D-Druck Firma FIT AG aus Lupburg war es so: Ich habe die Produktion besucht, eine Führung gemacht und zu Hause in meiner Werkstatt in Weimar angefangen, Ideen zu entwickeln.“ Am Ende stand ein Entwurf, der das Material als Ausgangspunkt nahm und seine Eigenschaften optimal nutzte. Für Gerlach ist es essenziell, noch tiefer in verschiedene Forschungsbereiche einzutauchen, Wissen zu sammeln und daraus Neues zu generieren. “Ich sehe mich nicht nur als Designer, sondern vor allem als Vermittler und stelle durch meinen Kontakt zu verschiedensten Bereichen Verknüpfungen her, die für den nachhaltigen Wandel sinnvoll sind. Die Informationen, die ich erhalte, versuche ich dann wie ein Puzzle zusammenzusetzen und die neuen Erkenntnisse für die Industrie, aber auch die Designbranche sichtbar zu machen.” Deshalb plant Friedrich, der auch als Videograf arbeitet, eine dokumentarische Bestandsaufnahme industrieller innovativer Prozesse – filmisch erzählt, um nachhaltige Potenziale, die es bereits gibt, nach außen zu tragen. “Ich möchte andere einladen, mitzumachen, ihre eigenen Ideen zu verfolgen und weiterzudenken.“

Blick in die Zukunft: Welche Rolle Designer:innen spielen müssen
Jedoch läuft das mit der Zusammenarbeit mit der Industrie und der Sensibilisierung anderer Branchen und Bereiche längst nicht immer so “fluffig”, wie beim Projekt mit der FIT AG. Oft sei es für Unternehmen schwer zu verstehen, was seine Visionen und Ideen als kreativer Gestalter mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit wirklich bedeuten. “Als Gestaltende hängen wir irgendwo zwischen Wissenschaft, Technik und Design und müssen immer sorgfältiger Brücken zwischen den Bereichen schlagen“, erklärt er. Viele Unternehmen – besonders im Mittelstand – seien so tief in ihrem Daily Business verwurzelt, sodass sie den Blick nicht über Altbekanntes hinaus richten. Aber Friedrich hat dahingehend Hoffnung: “Wenn es um den Blick über den Tellerrand geht, kommen wir als Kreative ins Spiel. Wir erkennen die Bedürfnisse und entwickeln Lösungen, die nachhaltig und wirtschaftlich sinnvoll sind.“ Gerade externe Designer:innen brächten frische Perspektiven in Unternehmen und könnten festgefahrene Strukturen aufbrechen.
“Etwas zu 100% nachhaltig zu machen, ist fast unmöglich“, gibt er zu. “Man kann immer nur abwägen – zwischen Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Kreislauffähigkeit. Es gibt verschiedene Strategien und meistens ist die Lösung eine Mischung aus vielen Faktoren.“ Diese komplexen Entscheidungen sind Teil der täglichen Herausforderungen des Produktdesigners, denen er sich gerne weiterhin stellen möchte. Dafür erschließt er sich fortwährend neue Themengebiete, “wie zum Beispiel bei unserem Biozement-Projekt – daraus könnte eine ganze Firma entstehen, die sich intensiv damit beschäftigt. Aber ich will nicht nur in einem Bereich bleiben, sondern immer weiter neue Felder erkunden.“
„Nachhaltigkeit darf keine Ausnahme sein, sie muss zur Norm werden“
Nachhaltige Konzepte als monetäres Geschäftsmodell
Doch genau hier stellt sich eine zentrale Frage: Wie können die Visionen finanziell tragfähig werden? “Design wird oft als eine Art Hobby angesehen. Als etwas, das man mit Leidenschaft tut und den Designer:innen Spaß macht. Dabei leisten wir harte Arbeit, die einen echten Impact hat“, betont Friedrich Gerlach. Gerade für junge Designer:innen sei das Thema Bezahlung ein Problem: “Viele Jobs – besonders Trainee-Stellen – werden schlecht oder gar nicht bezahlt. Dabei ist unsere Arbeit ein elementarer Teil für die Zukunft.“ Sein Rat für angehende Designer:innen: Im Austausch bleiben. Es reiche nicht, in der eigenen Bubble Ideen weiterzuspinnen. Man müsse rausgehen, schauen, wie Unternehmen produzieren, mit Forschungseinrichtungen ins Gespräch kommen und Althergebrachtes hinterfragen. “Es gibt viele, die offen für den Transfer von Wissenschaft in Design sind – aber eben auch diejenigen, die sagen: ‘Wir haben das schon immer so gemacht’.‘“ Friedrich erinnert sich an eine Begegnung mit einem schlecht gelaunten Metallarbeiter während seines Studiums: “Der meinte zu meinen alternativen Vorschlägen: ‘Das wird nicht klappen!‘. Aber genau das ist doch der Punkt: Wenn etwas nicht klappt, ist das eine Chance, weiter zu forschen und etwas Neues zu probieren.“ Für den Designer ist diese Überzeugungsarbeit Kern seiner Tätigkeit. Er appelliert an den Mut von Unternehmen, Ergebnisoffenheit auszuhalten: “Im Gegensatz zu vielen anderen Berufen ist die Ergebnisoffenheit bei meiner experimentellen Tätigkeit als Produktdesigner deutlich höher: Man weiß nicht, was hinten rauskommt, welche Form aus dem neuen Material entstehen kann. Das stellt mich bei der Arbeit mit traditionellen Unternehmen oftmals vor Herausforderungen. Dabei ist es spannend und wichtig, Menschen für neue Denkweisen zu gewinnen. Am Ende entstehen daraus Innovationen, die sonst nie möglich gewesen wären.“
Genau das treibt ihn an: das Beobachten, Experimentieren, Entwickeln. Auch an seiner eigenen Uni testet er neue Gestaltungsmöglichkeiten. Ein Beispiel ist die mobile Sauna, die er gemeinsam mit anderen Studierenden auf dem Campus gebaut hat. “Wir haben uns gefragt, wie wir eine Sauna für die Studierenden bereitstellen können, die aus neuen, leichten Materialien besteht und einfach zu transportieren ist.“ Seit zwei Jahren steht sie nun auf dem Campus – und wird regelmäßig genutzt. “Solche Projekte zeigen, was möglich ist, wenn man bereit ist, neue Wege zu gehen.“

Nachhaltigkeit als Haltung – und nicht als Trend
Friedrich Gerlach zeigt mit seinen Projekten, dass nachhaltiges Design nicht nur möglich, sondern notwendig ist. Er denkt Materialien und Prozesse neu, vernetzt Wissenschaft, produzierende Unternehmen und Gestaltende interdisziplinär und fordert die Industrie heraus, ressourcenschonende Alternativen ernst zu nehmen. Doch für ihn ist nachhaltiges Design mehr als ein technischer Ansatz – es ist eine Haltung. Eine, die über den Produktentwurf hinausgeht und den gesamten Lebenszyklus eines Produkts mit einbezieht.
Sein Ziel ist klar: Nachhaltigkeit soll nicht länger die Ausnahme sein, sondern zur Selbstverständlichkeit werden. Dafür braucht es Mut, Zusammenarbeit und den Willen, herkömmliche Strukturen zu hinterfragen. “Wenn wir es richtig machen, kann Design echten Wandel bewirken.“
Kontakt
www.friedrichgerlach.de
Instagram: friedrich_gerlach
THAK-Tipp:
Wer mehr über nachhaltige Materialien und zukunftsweisende Herstellungsprozesse erfahren möchte, sollte Friedrich Gerlach nicht verpassen:
Bei unserer #kreativgelöst: Zukunft Bauen gibt er am 10. Juli einen 15-minütigen Impuls – über 3D-gedruckte Sofas, Biozement und seine Vision für nachhaltiges Design.
Dein Interview auf unserer Webseite?
Kontaktiere mich!
Nina Palme
Kommunikation
np@thueringen-kreativ.de0151 / 1290 4638Das könnte dir auch gefallen: